MIKROFONE
Eine kurze Einführung
Eines vorweg : Dieser Aufsatz kann
und will nur einen groben Überblick über das Thema geben und ersetzt
deshalb kein vertiefendes Studium mit Hilfe von Fachliteratur und Praxiserfahrung.
Wir werden die prinzipiellen Unterscheidungsmerkmale von Mikrofonen kennenlernen
und uns um die praktischen Einsatzkriterien bei stereofonen Aufnahmen kümmern.
Und schon geht es los. Die Überschrift des ersten Kapitels lautet:
Die beiden
wichtigsten Arbeitsprinzipien von Mikrofonen
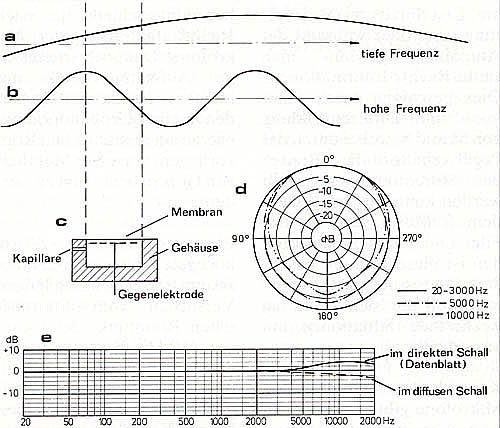
Ein
Volumen wird durch eine Membrane abgeschlossen und reagiert dadurch auf Luftdruckänderungen
vor der Membrane. Man kann sich das wie einen geschlossenen Lautsprecher vorstellen.
Das sich keine Vorspannung durch den Luftdruck ergibt ist eine (oder mehrere)
Kapillare im Gehäuse angebracht, die für einen stetigen Druckausgleich
sorgen. Gegenüber den Druckschwankungen einer Schallwelle ist das Volumen
aber dicht abgeschlossen. Dadurch bewegt sich die Membrane durch den Schalldruck
der vor dieser herrscht. Aus welcher Richtung die Schallwelle kommt ist dabei
fast egal. Nur zu höheren Frequenzen ergibt sich eine kleine Richtwirkung,
wie im nebenstehenden Diagramm angegeben.
Druckempfänger sind also reine Kugelmikrofone. Da der Frequenzgang im Diffusfeld
einen Höhenverlust aufweist richtet man auch Kugelmikrofone in der Regel
auf die Schallquelle aus. Man bekommt mit steigenden Abstand von der Schallquelle
ein dunkleres Klangbild.
2.) Der
Druckgradientenempfänger
Der
Druckgradient ist die Schalldruckdifferenz zwischen zwei eng beieinanderliegenden
Schalleintrittsöffnungen eines Mikrofons. Das typische Druckgradientenmikro
ist das Achtermikrofon. Die Menbran wird von beiden Seiten in gleicher Weise
vom Schall erreicht. Das Equivalent in der Lautsprechertechnik ist der Dipolstrahler
z.B. ein elektrostatischer Lautsprecher. Trifft der Schall von vorne oder hinten
senkrecht auf die Membrane so enstehen ausgeprägte "Hoch- und Tiefdruckgebiete"
vor und hinter der Kapsel, welche die Membrane stark auslenkt. Trifft die Schallwelle
dagegen im 90-Grad Winkel auf die Membrane so ist der Schalldruck an der Vorderseite
und an der Rückseite der Membrane gleich groß und es findet keine
Auslenkung statt. Druckgadientenempfänger besitzen eine relativ schwache
Tieftonempfindlichkeit, da die Wellenlänge sehr groß ist im Vergleich
zur Größe der Kapsel. Deshalb ist auch der Druckunterschied zwischen
Vorder- und Rückseite gering.
Der Diffusschall wird in der Regel leiser aufgenommen als der Direktschall jedoch
ist der Frequenzgang von Direkt- und Diffusfeld gleich. So besitzen Druckgradientenempfänger
eine "natürliche" Rückkopplungsdämpfung. Es muss aber
weiter entfernt von der Schallquelle aufgestellt werden wenn man die gleiche
Hallbalance wie bei der Kugel haben möchte. Aus der Überlagerung von
Kugel und Acht ensteht übrigens die weitverbreitete Nierencharakteristik
mit besonders geringen Diffusfeld und starker Rückkopplungsdämpfung.
Nachdem wir uns um die Arbeitsprinzipien
gekümmert haben, wollen wir wir jetzt ein Mikro bauen. Kapitel zwei:
Die drei
wichtigsten Konstruktionsprinzipien von Mikrofonen
1.) Das
dynamische Tauchspulen-Mikrofon
Dynamische
Mikrofone sind weitverbreitet, da sie relativ einfach aufzubauen sind und günstig
produziert werden können. Der bekannteste Vertreter ist ohne Zweifel das
Shure SM-58. Die allermeisten Bühnenmikrofone und praktisch alle Mikrofone
für Disco und DJ arbeiten nach dem dynamischen Prinzip. Dabei wird eine
Spule (Schwingspule) von den Schallwellen über eine Membrane angetrieben.
Diese Spule bewegt sich dabei zwischen den Polen eines Magnetfeldes, welches
eine der Spulenbewegung propotionale Spannung in die Spule induziert. Dynamisch
Mikrofone können sowohl als Druckempfänger oder als Druckgradientenempfänger
ausgeführt sein. Die Ähnlichkeit mit Hochton-Lautsprecherchassis kommt
nicht von ungefähr. Das Prinzip ist genau gleich und tatzächlich könnte
ein dynamisches Mikro auch Schall wiedergeben!
2.) Das
Kondensator-Mikrofon
Kondensatormikrofone
gelten als die besten überhaupt. Alle großen hochqualitativen Studiomikrofone
sind Kondensatormikrofone. Das Prinzip ist einfach, denoch kosten solch Mikrofone,
wegen der notwendigen hohen Prazision und der Verwendung besonderer Materialen,
ein vielfaches der dynamischen Modelle. Eine wenige tausendstel Millimeter starke
Kunststoff oder Metallmenbran bewegt sich in geringem Abstand von wenigen tausendstel
Millimeter zu einer festen Metallplatte. Diese bilden zusammen die Platten eines
Kondensators. Durch Schalleinwirkung ändert sich der Abstand der beiden
Elektroden. Das ergibt eine der Schallwelle propotionale Kapazitätsänderung.
Um
jetzt eine der Kapazitätsänderung propotionale Spannung zu erhalten,
benötigt man an den Elektroden eine Polarisationsspannung. Diese wird heute
entweder durch eine sogenannte Phantomspeisung von 48V von außen an die
Kapsel gebracht. Die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Elektretmikrofon.
Dabei ist die Polarisationsspannung als feste elektrostatische Ladung auf den
Elektroden. Solche Kondensatormikrofone sind meist etwas günstiger aber
trotzdem sehr gut. Die von den Kondensatorkapseln abgegebene Spannung ist meist
viel höher als die von dynamischen Mikros und besitzen auch immer eine
Verstärkerschaltung im Griff, welche hauptsächlich als Impedanzwandler
arbeitet und den hohen Widerstand der Kapsel an den geringeren des Mikroeinganges
anpasst. Dafür benötigen dann auch Elektretmikrofone eine geringe
Versorgungsspannung, die dann oft mit Batterien erzeugt wird.
Im ersten Kapitel haben wir bereits
zwei Richtcharakteristika kennengelernt: Die Kugel und die Acht. Die wichtigste
aber ist die Niere und die wollen wir jetzt einmal genauer kennenlernen.
3.) Richtcharakteristik
Niere
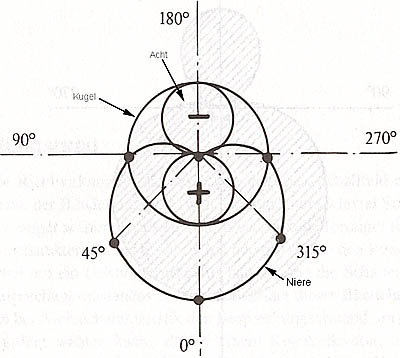
Ein Mikrofon mit nierenformiger
Richtcharakteristik besitzt in Achsrichtung (0 Grad) volle Empfindlichkeit,
bei seitlicher Beschallung sinkt die Empfindlichkeit auf die hälfte und
bei rückwärtigen Schalleinfall auf etwa ein Zehntel.
Das entstehen der nierenförmigen Richtcharakteristik kann man sich aus
nebenstehender Grafik als Überlagerung aus Kugel und Acht vorstellen.
Durch den bei der Acht entstehenden "negativen" Schalldruck findet
eine Auslöschung in 180 Grad statt, da die Kugel von überallher
nur "positiven" Schalldruck empfängt. Da sich Plus und Minus
aufheben kommt es zur Niere.
Nachfolgend ein Schnitt durch eine Nieren-Mikrokapsel. Man erreicht die Niere
durch eine "Kombikapsel" aus Acht und Kugel. Die Kapsel besitzt
einen offenen Bereich welcher eine Acht produziert und einen geschlossenen
Bereich mit Kugelcharakter.
Das soll uns theoretisch zum Thema Niere genügen. Im nächsten Kapitel
geht es nun ans Eingemachte : Wie nehme ich stereofon auf?
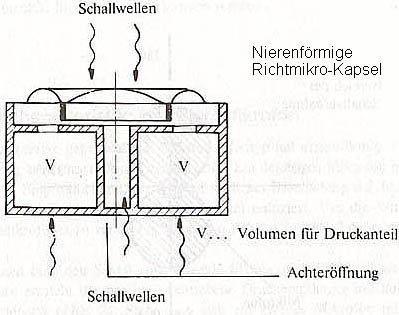
Die stereofone Aufnahmetechnik
1.) XY-Verfahren
Eines
ist klar: Man benötigt mindestens zwei Mikrofone. Aber darüberhinaus
stellen sich viele Fragen. Wie weit stellt man die Mikrofone von der Schallquelle
weg? Wie weit müssen die Mikrofone voneinander entfernt werden? Müssen
die Mikrofone angewinkelt werden? und vieles mehr. Nun haben sich in den letzten
hundert Jahren viele kluge Köpfe darüber Gedanken gemacht, deshalb
kann man heute auf gesicherte Erkenntnisse zurückgreifen. Wir wollen uns
mit folgenden Aufnahmeverfahren auseinander setzen : XY-Verfahren, ORTF-Stereo,
AB-Verfahren. Wer die drei Aufnahmeverfahren beherrscht, kann damit jede stereofone
Aufnahmesituation meistern
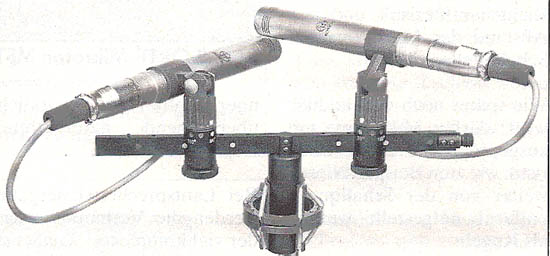
Als
erstes also das XY-Verfahren. Wie auf nebenstehenden Bild zu sehen ist der Abstand
zwischen den Mikrokapseln 0cm! Sie stehen direkt übereinander. Der Winkel
sollte zwischen 90 und 120 Grad liegen. Als Kapseln kommen nur Nieren in Frage,
da es sonst keinerlei stereofone Information geben würde. Der Winkel zwischen
den Kapseln stellt den maximalen Aufnahme-winkel ein. Die XY-Aufnahmetechnik
ist gekennzeichnet durch eine besonders gute Lokalisation der Schallquellen
in der Mitte, wirkt aber nicht besonders breit.
Die
räumliche Abbildung ist schlecht, da jegliche Laufzeitunterschiede fehlen.
Das XY-Verfahren zählt somit zu den Intensitäts-Mikrofonie-Verfahren
und es kann für erste Versuche empfohlen werden, da es relativ einfach
ist. Ein gutes Ergebnis ist fast garantiert, wenn man den passenden Aufnahmewinkel
und Entfernung eingestellt hat (siehe später).
Das
ORTF-Verfahren wurde von Technikern des französischen Rundfunks entwickelt
und hat sich zum vielleicht beliebesten stereofonen Aufnahmeverfahren entwickelt.
Ausgehend vom XY-Verfahren stellt man die Nierenkapseln in 17 cm Entfernung
auf und winkelt sie um 110 Grad ein. Es entsteht ein Aufnahmefeld von etwa +-
50 Grad von der Mittelachse. Um ein Orchester komplett aufzunehmen, muss die
ORTF-Anordnung soweit von diesem entfernt aufgestellt werden das alle Instrumente
sich inerhalb dieser Aufnahmezone befinden. Ein Öffnungswinkel von 100
Grad ist in der Regel ausreichend, außer man muss aus akustischen Gründen
nahe an der Schallquelle sein (Hallradius, siehe unten).
Dann muss man von der "reinen
Lehre" des ORTF-Verfahrens weg und Abstand und Winkel selbst einstellen,
doch dazu später mehr. Das ORTF-Verfahren ist darüberhinaus sehr
unkritisch in der Plazierung und wird von vielen Anwendern als besonders universelle
Lösung angesehen. Die Räumlichkeit ist ausgewogen und die Lokalisation
der Instrumente gut. Ein naher Verwander des ORTF-Verfahrens ist die Anordnung
nach DIN. Dabei beträgt der Abstand der Nierenkapseln 20 cm und der Winkel
90 Grad. Man kommt ebenfalls zu einem Aufnahmewinkel von +- 50 Grad. Welch
der beiden Verfahren zu bevorzugen ist, muss man bei jeder Aufnahme durch
eine Mikrofon-Probe ermitteln.
3.) Das
AB-Verfahren
Das
AB-Verfahren stellt das ursprünglichste stereofone Aufnahmeverfahren dar.
Man benötigt im Gegensatz zum XY- und ORTF-Verfahren Mikrokapseln mit Kugelcharakteristik.
Daraus ist schon zu erkennen, das bei diesem Verfahren der Winkel zwischen den
Kapseln eine untergeordnete Rolle spielt. Trotzdem sollten die Kapseln auf das
Schallereignis ausgerichtet sein. Man stellt beide Kapseln einfach in einer
Entfernung von 40 cm bis zu mehreren Metern zueinander in einer Linie auf. Bewährt
hat sich dabei etwa 50 cm Entfernung. Das AB-Verfahren ist die Diva unter den
stereofonen Aufnahmeverfahren. Einerseits bekommt man nur durch die Benutzung
von Kondensator-Kugelkapseln den natürlichen tieffrequenten Anteil am Spektrum
der Musikinstrumente, andererseits kann eine schlechte AB-Aufnahme lächerliche
Ergebnisse liefern. Man sollte also wichtige Aufnahmen nicht ausschließlich
im AB-Verfahren durchführen, sonst könnte man eine unangenehme Überraschung
erleben. Die Lösung stellen die sogenannte Trennkörperstereofonie
dar, deren bekannteser Vertreter die "Jecklin-Scheibe" ist. Das ist
eine Anordnung von zwei Kugelmikrofonen mit einem gegnseitigen Abstand von 36cm
und durch eine Scheibe von 35cm Durchmesser akustisch getrennt. Die Scheibe
ist mit schallabsorierenden Material belegt.
Raumakustische
Besonderheiten
1.) der
Hallradius
Bei Aufnahmen spielt die Raumakustik
eine noch größere Rolle als für das unmittelbare Live-Hören.
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass stereofone Wiedergabe nur
eine Illusion des natürlichen Geschehens sein kann und einige Informationen
fehlen wie alles Visuelle und das Ambiente.
In der Nähe eines Instrumentes hört man auch in einem Raum dominierend
den direkten Schall und empfindet den Raumeinfluß weniger. Weiter entfernt
ist aber der reflektierte Schall und damit der Raumeinfluß stärker.
Das Verhältnis von direkten und reflektierten Schall nennt man die Hallbalance.
Dort wo direkter und reflektierter Schall gleich groß ist befindet sich
der Hallradius dieser Schallquelle.
Aufnahmen sollten immer innerhalb des Hallradius gemacht werden, da sich das
Ergebnis der Aufnahme ansonsten kaum noch verwerten lässt.
Die Größe des Hallradius
lässt sich mit folgender Formel annähernd berechnen:
Hallradius = 0,057
* Wurzel(Raumvolumen/Nachhallzeit)
Wobei gilt: Hallradius in Meter,
Raumvolumen in Kubikmeter und Nachhallzeit in Sekunden.
2.) Die
Williams-Diagramme
Die Williams-Diagramme erfassen
den Zusammenhang zwischen Mikrofonabstand, Öffnungswinkel und Aufnahmewinkel
bei stereofonen Mikroanordnungen. Damit kann man von der ORTF- oder DIN-Anornung
weggehen und eigene Anordnungen kreieren. Deren Soundqualität ist aber
nicht sichergestellt und man muss immer in einer Mikrofon-Probe deren Brauchbarkeit
in dieser Aufnahmesituation ermitteln. An der waagerechten Achse liest man
dabei den Mikroabstand ab, an der senkrechten Achse den Öffnungswinkel
und als Parameter der Kurvenschar bekommt man den max. Aufnahmewinkel der
Anordnung. Nachfolgend ist das Williams-Diagramm für Nierenkapseln angegeben.
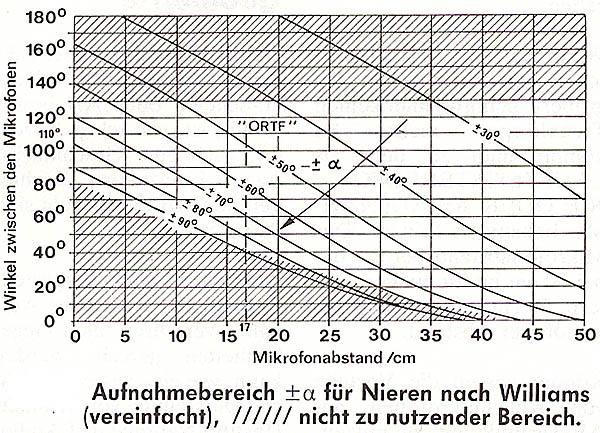
So, das soll es gewesen sein. Mit
diesem Wissen kann man sich ans Werk machen und seine erste stereofone Aufnahme
in den Kasten bringen. Es sollte sich auf Anhieb ein Erfolg einstellen. Ansonsten
gilt wie für alles: "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen".
Literatur:
Stereoplay / Grundlagen der HIFI-Technik
Vereinigte Motor-Verlage ohne Jahresangabe, Stuttgart
Stereoplay / Die Welt des Klanges Vereinigte Motor-Verlage 1995, Stuttgart
Norbert Pawera / Mikrofon-Praxis 3.Auflage 1993 Franzis-Verlag GmbH, München
Michael Ebner / Handbuch der PA-Technik Elektor-Verlag 2002, Aachen
Thomas Görne / Mikrofone in Theorie und Praxis Elektor-Verlag, Aachen
Frank Pieper / PA-Handbuch Carstensen-Verlag
Reichenberg,
30.09.2002
Jürgen Völker
HiFi-Club
>Die HIGH-FIDELIKER<